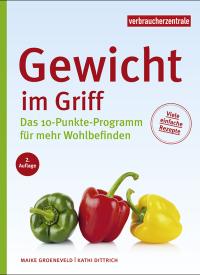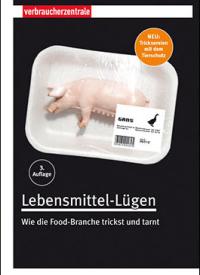Das Wichtigste in Kürze:
- Produktnamen bei Lebensmitteln spiegeln selten die Zutaten wider und sind eher als Fantasienamen zu verstehen.
- Ein Blick auf Bezeichnung und Zutatenliste verrät die genaue Zusammensetzung.
- Auch wenn die Begriffe "Milch" und "Käse" gesetzlich für tierische Produkte geschützt sind, gibt es doch erlaubte Ausnahmen.
- Der scheinbare Herstellungsort wie Kloster oder Bauernhof bezieht sich oft nur auf traditionelle Rezepte.
Irrtümer bei Zutatenangaben
Bayerischer Leberkäse
Anders als der Name vermuten lässt, enthält "Bayerischer Leberkäse" in der Regel keine Leber. Während "Leberkäse" auch Leber enthält, ist dies bei "Bayerischem Leberkäse" laut den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse nicht so. Er entspricht eigentlich der Zusammensetzung von "Fleischkäse". Dagegen gehört in "Stuttgarter Leberkäse" mindestens 5 Prozent Leber; auch grober Leberkäse soll zu fünf Prozent aus Leber bestehen.
Schwarze Oliven
Bei "schwarzen Oliven" handelt es sich nicht immer um natürlich gereifte Oliven, sondern häufig um schwarz gefärbte grüne Oliven. Bei loser Ware und in der Gastronomie müssen geschwärzte Oliven als "geschwärzt" kenntlich gemacht werden. Auf fertig verpackten Oliven darf dieser Hinweis jedoch fehlen. In der Zutatenliste ist dann lediglich ein zugesetzter Stabilisator – Eisen-II-Gluconat (E 579) oder Eisen-II-Lactat (E 585) – aufgeführt.
Hirtenkäse
Im Supermarkt kann statt einem griechischen Schafskäse leicht ein Hirtenkäse oder Käse in Salzlake im Einkaufswagen landen - die preiswertere Variante aus Kuhmilch. Denn die Aufmachung der Produkte ist sehr ähnlich. Bei Produkten, die nach Schafskäse aussehen, müssen Sie genau auf die Verpackung schauen. Ohne Angabe einer bestimmten Tierart in der Zutatenliste oder Bezeichnung besteht der Käse in der Regel aus Kuhmilch. Nur, wenn "Feta" draufsteht, handelt es sich um einen griechischen Schafskäse. Er trägt das europäische Herkunftskennzeichen "geschützte Ursprungsbezeichnung". Es legt fest, woraus, wie und wo Feta garantiert hergestellt wird: ein aus Schafs- und eventuell Ziegenkäse bestehender Weißkäse, der in Salzlake gereift ist und in bestimmten Gebieten Griechenlands hergestellt wurde.
Kalbsleberwurst
Lange Zeit musste eine Kalbsleberwurst überhaupt keine Kalbsleber enthalten. Die Leber stammte in der Regel vom Schwein. Inzwischen darf eine Kalbsleberwurst nur als solche bezeichnet werden, wenn tatsächlich mehr als 50 Prozent der Leber vom Kalb oder Jungrind stammen. Der Rest darf Schweinefleisch sein. Ist Kalbfleisch, aber weniger als 50 Prozent oder gar keine Kalbsleber enthalten, soll die Bezeichnung "Kalbfleisch-Leberwurst" lauten. Gleichwohl steckt in der Regel Schweinefleisch in der Kalbs- oder Kalbfleischleberwurst. Dies sollte aus der Bezeichnung auch deutlich werden, zum Beispiel "Kalbsleberwurst mit Schweinefleisch" – so schreiben es die aktuellen Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs vor.
Körnerbrot und Mehrkornbrötchen
"Körner" sind nicht dasselbe wie Vollkorn. Backwaren mit Bezeichnungen wie "Mehrkornbrötchen", "Vierkornbrot" und "Kornspitz" müssen nicht aus Vollkornmehl hergestellt sein. Hinter dem "Vollkorn-Look" verstecken sich häufig Brot und Brötchen aus hellen Mehlen, die mit Körnern dekoriert sind oder Ölsaaten wie Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Sesam im Teig enthalten. Nur wenn ausdrücklich "Vollkorn" draufsteht, muss auch Vollkornmehl oder Vollkornschrot verarbeitet sein – und zwar zu mindestens 90 Prozent im Mehlanteil.
Unbehandelte Zitrusfrüchte
Bei Zitronen oder Zitrusfrüchten findet man noch häufig den Hinweis "unbehandelt". Unbehandelt heißt keineswegs frei von Schadstoffen. Diese Angabe besagt nur, dass die Früchte nach der Ernte nicht konserviert oder gewachst wurden. Sie sagt jedoch nichts darüber aus, ob die Früchte während des Wachstums mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden. Wenn die Oberfläche der Zitrusfrüchte nach der Ernte mit Wachsen oder mit Konservierungsmitteln gegen Verderb und Austrocknen behandelt wurden, muss dies mit den Hinweisen "gewachst", "mit Konservierungsstoff" oder "konserviert" gekennzeichnet werden.
Kam Thiabendazol zum Einsatz, lautet der Hinweis "konserviert mit Thiabendazol". Die Schale dieser Früchte ist nicht zum Verzehr geeignet. Wer die Schale von Zitrusfrüchten zum Beispiel als Zutat für Kuchen verwenden möchte, sollte daher auf Bio-Ware zurückgreifen. Hier ist die Behandlung der Schale mit Konservierungsstoffen und Wachsen verboten. Auch der Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist nicht erlaubt, sodass keine Rückstände in der Schale verbleiben.
Bezeichnungsschutz für Milch, Butter und Käse
Laut Gesetz dürfen die Begriffe "Milch", "Butter" und "Käse" nur für tierische Erzeugnisse verwendet werden. Stammt die Milch von einer anderen Tierart als der Kuh, muss diese explizit genannt werden, wie zum Beispiel Ziegenkäse. Eine milchähnliche Flüssigkeit aus Soja oder Hafer darf daher nur als Hafer-Drink bzw. Pflanzendrink, nicht aber als Pflanzenmilch bezeichnet werden. Gleiches gilt für Tofubutter oder Pflanzenkäse. Für ein paar wenige Lebensmittel gibt es jedoch gesetzlich festgelegte Ausnahmen, etwa Kokosmilch, Liebfrauenmilch (Wein), Butterbirne, Erdnussbutter, Fleischkäse oder Kakaobutter.
Irrtümer bei Herkunftsangaben
Klosterprodukte
Rechtlich ist der Begriff "Kloster" nicht geschützt. Es gibt sicherlich Orden, die ihre eigenen Produkte und Lebensmittel mit guter Qualität anbieten. Das Prädikat "Kloster" sagt jedoch nichts darüber aus, wie ein Lebensmittel hergestellt wird. Einen Hinweis gibt nur der Blick auf das Etikett: Stehen dort nur Zutaten, die bei solchen Produkten erwartet werden? Kommen in "Kloster-Pralinen" beispielsweise neben Nougat, Zucker und Nüssen auch Vollmilchpulver oder der Emulgator Sojalecithin vor, also Stoffe, die üblicherweise bei der industriellen Produktion eingesetzt werden?
Diese haben in Klosterprodukten eher nichts zu suchen. Ebenso unglaubwürdig wäre ein "Kloster-Tee" mit dem Aufdruck "verpackt in Hamburg", der zudem noch künstliche Aromen enthält.
Imkerhonig
Die Bezeichnung erweckt oft durch regionale Adressen und Bebilderungen den Anschein, dass er vom regionalen Erzeuger stammt. Tatsächlich kann es sich dabei aber auch nur um den Betrieb handeln, der den Honig abgefüllt hat. Der Honig kann von Bienen in aller Welt stammen. Die verpflichtende Angabe zum Herkunftsland wird oftmals wenig prominent im Kleingedruckten auf der Rückseite der Verpackung versteckt. Ganz im Vagen bleibt die Herkunft, wenn es sich um Honigmischungen aus unterschiedlichen Herkunftsländern handelt: Hier müssen sich Verbraucher:innen beispielsweise mit der Angabe "aus EU-Ländern und/oder Nicht-EU-Ländern" zufrieden geben.
Dies ändert sich jedoch ab Sommer 2026. Mit der neuen Vermarktungsrichtlinie für Honig, Fruchtsäfte, Konfitüren und Milch, auch Frühstücksrichtlinie genannt, wird die Herkunftskennzeichnung auf den Etiketten verpflichtend. Darüber hinaus muss dann bei Honigmischungen der Ursprung in prozentualen Anteilen in absteigender Reihenfolge ausgewiesen werden.
Wer sicher gehen möchte, dass der Honig aus Deutschland stammt, sollte Honig des Deutschen Imkerbundes e.V. kaufen. Man erkennt ihn am geprägten Glas und Deckel. Das Imker-Honigglas ist ein rechtlich geschütztes Warenzeichen. Übrigens ist der Hinweis "kalt geschleudert" auf dem Honigglas nicht mehr erlaubt, da jeder käufliche Honig kalt geschleudert wird.
Packstellenangabe bei Eiern
Auch wenn auf dem Eierkarton eine deutsche Packstelle angegeben ist, können die Eier zum Beispiel aus den Niederlanden stammen. Das ist zulässig, denn das Ursprungsland muss im Erzeugercode stehen – im Stempel auf dem Ei – nicht auf der Verpackung.
Letztlich hilft nur der Blick auf das Ei, um sicher zu sein, woher es stammt. NL steht beispielsweise für die Niederlande, DE für Deutschland. Auch das Bundesland lässt sich erkennen. Auf der Internetseite "Was steht auf dem Ei?" erfahren Sie durch Eingeben des Erzeugercodes Name und Adresse des Legebetriebes - allerdings nur für dort registrierte Betriebe.
Video "Wie viel 'Fitness' steckt im Fitness-Brötchen?" laden: Erst wenn Sie auf "Inhalt anzeigen" klicken, wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt und Daten werden dorthin übermittelt. Hier finden Sie dessen Hinweise zur Datenverarbeitung.