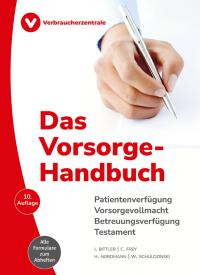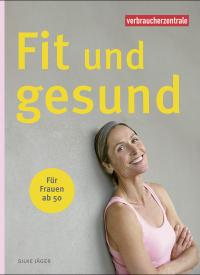Das Wichtigste in Kürze:
- Die geförderte Pflegezusatzversicherung bekommen Sie auch, wenn Sie Vorerkrankungen haben. Es findet keine Gesundheitsprüfung statt.
- Die versicherten Leistungen sind jedoch meist sehr gering. Sie decken nicht annähernd den anzunehmenden finanziellen Bedarf.
- Man kann davon ausgehen, dass der Beitrag für diese Versicherung zukünftig deutlich steigen wird.
- Auch im Pflegefall müssen Sie den Versicherungsbeitrag weiter zahlen.
Pflege ist teuer und kann jeden betreffen
Niemand weiß, ob er im Alter ein Pflegefall werden wird. Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt regelmäßig zu. Die meisten Menschen werden zu Hause versorgt. Nur etwa jede:r 5. geht in ein Pflegeheim. Häufig kümmern sich Angehörige zu Hause um die Pflege oder ambulante Pflegedienste. Pflege kostet umso mehr, je mehr professionelle Hilfe Sie in Anspruch nehmen.
Mit folgenden eigenen Kosten für Pflegedienste müssen Sie im ambulanten Bereich etwa rechnen, nachdem die Pflegekasse ihren Teil gezahlt hat:
| Versorgungslücke bei ambulanter Pflege | |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 150 Euro |
| Pflegegrad 2 | 600 Euro |
| Pflegegrad 3 | 1.300 Euro |
| Pflegegrad 4 | 2.600 Euro |
| Pflegegrad 5 | 2.600 Euro |
Quelle: Finanztest 07/23, S. 83.
Im Einzelfall können die Kosten höher oder auch geringer ausfallen.
In Pflegeheimen sind die Kosten für Bewohner:innen seit dem 1. Januar 2017 in den Pflegegraden 2 bis 5 gleich hoch. Es gilt ein einheitlicher Eigenanteil. Neben den Kosten für die pflegerische Versorgung müssen die Bewohner:innen im Heim für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten zahlen. Künftig werden die Preise vermutlich weiter steigen.
Stationär müssen Sie von folgenden Kosten ausgehen:
| Versorgungslücke bei stationärer Pflege | |
|---|---|
| Pflegegrad 2 | 1.500 Euro |
| Pflegegrad 3 | 1.500 Euro |
| Pflegegrad 4 | 1.500 Euro |
| Pflegegrad 5 | 1.500 Euro |
Quelle: Finanztest 07/23, S. 83
Für Unterkunft und Verpflegung müssen Sie die jeweiligen Kosten hinzurechnen. In Pflegeheimen beträgt der gesamte Eigenanteil von Pflegebedürftigen derzeit bundesweit durchschnittlich 3.387 Euro pro Monat in Grad 2 bis 5. Hiervon müssen monatliche Zuschüsse der Pflegekasse abgezogen werden - jeweils abhängig von der Verweildauer. Der Eigenanteil in Grad 1 ist immer noch etwas höher, weil die Pflegekasse dort nur 131 Euro monatlich übernimmt.
Die Preise sind zum einen regional unterschiedlich. Zum anderen variieren die Kosten der einzelnen Heime stark. Preisvergleiche können sich lohnen. Hilfreich kann es sein, bei in Frage kommenden Pflegeheimen zu fragen, wie hoch die Kosten derzeit sind. Im Pflegenavigator der AOK und im Pflegelotsen können Sie Einrichtungen an Ihrem Wohnort suchen und die Kosten einsehen.
Die meisten Pflegebedürftigen sind in niedrigen Pflegegraden 1 bis 3 von 5 Graden eingestuft. Zum 31. Dezember 2023 sah die Verteilung in der gesetzlichen Pflegeversicherung in den Pflegegraden wie folgt aus:
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verteilung ambulant | 17,7 Prozent | 43,8 Prozent | 27,6 Prozent | 8,4 Prozent | 2,6 Prozent |
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung, Stand: 15. Juli 2024.
Frauen sind von Kosten der Pflegebedürftigkeit stärker betroffen, da sie eine höhere Lebenserwartung haben und im Alter häufiger alleinstehend sind.
Besonderheiten der geförderten Verträge
Um die möglichen finanziellen Lücken zu schließen, bieten Versicherungsunternehmen Pflegezusatzversicherungen an, die im Pflegefall Gelder auszahlen. Ob eine solche Versicherung sinnvoll ist, lesen Sie im verlinkten Artikel.
Gern wird die Pflegezusatzversicherung mit staatlicher Förderung von 5 Euro pro Monat angeboten. Diese Förderung müsse man mitnehmen, ist ein häufiges Argument in Verkaufsgesprächen. Doch lohnen sich diese Verträge und sind sie im Vergleich zu anderen Produkten empfehlenswert?
Zunächst kann jeder, der volljährig ist und noch keine Leistungen aus der Pflegeversicherung erhält, einen geförderten Vertrag abschließen. Der Gesundheitszustand und auch das Alter spielen keine Rolle. Häufig sind Verbraucher:innen an diesem Produkt interessiert, die keine andere Pflegezusatzversicherung erhalten, weil sie Vorerkrankungen oder ein gewisses Alter erreicht haben.
Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass eine Einstufung im Rahmen der gesetzlichen Pflegeversicherungen in die dortigen Pflegegrade 1 bis 5 erfolgt.
Kann die Pflegezusatzversicherung einen Vertragsschluss ablehnen?
Nein, es besteht Annahmezwang. Niemand darf wegen seiner Vorerkrankungen oder aufgrund seines Alters abgelehnt werden. Es dürfen im Rahmen der Verträge auch keine Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse verlangt werden. Folglich findet für diese Verträge keine Gesundheitsprüfung statt. Auch ein außerordentliches Kündigungsrecht des Versicherers darf es nicht geben.
Zahlen Sie pro Monat mindestens 10 Euro Versicherungsbeitrag, bekommen Sie die staatliche Zulage von monatlich 5 Euro. In der Praxis reduziert sich der Beitrag um 5 Euro. Das Versicherungsunternehmen erhält das Fördergeld über eine besondere Stelle.
Hatten Sie bereits eine Pflegeversicherung abgeschlossen, bevor das Gesetz über die geförderte Versicherung 2013 in Kraft trat, erhalten Sie dafür keine Zulage.
Was leisten die geförderten Zusatzversicherungen?
Es werden monatliche Beträge als Tages- oder Monatsgelder vereinbart. Die Verträge müssen mindestens eine Auszahlung von monatlich 600 Euro in Pflegegrad 5 vorsehen. Die Mindestleistungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:
| Pflegegrad | Pflegegeld |
|---|---|
| 1 | 60 Euro |
| 2 | 120 Euro |
| 3 | 180 Euro |
| 4 | 240 Euro |
| 5 | 600 Euro |
Diese Beträge sind sehr gering angesichts der oben genannten Finanzierungslücken, die Sie erwarten müssen. Einen Betrag von 600 Euro bekommen Sie zudem erst im höchsten Grad der Pflegebedürftigkeit, also Grad 5.
Im vorherigen System mit Pflegestufen waren von der Höchstsumme von 600 Euro noch mehr Menschen betroffen, da sie auch auf dem Niveau des heutigen Pflegegrades 4 (ehemals in Pflegestufe 3) die Höchstsumme bekommen konnten. Dadurch wurde das Produkt weiter abgewertet.
Die Erfahrung zeigt, dass besonders älteren Kund:innen nur die gesetzlichen Mindestleistungen angeboten werden. Wer sich darüber hinaus absichern möchte, dem werden meist andere Tarife als weitere Bausteine angeboten. Für diese gelten dann nicht mehr die gesetzlichen Bestimmungen. Auch sind mit diesen Bausteinen immer Gesundheitsprüfungen verbunden. Sie sollten verschiedene Tarife mit unterschiedlichen Bedingungen nicht nebeneinander abschließen.
Sie sollten grundsätzlich Verträge mit hohen Leistungen abschließen. Das heißt dann, der Beitrag ist entsprechend hoch. Schließen Sie deshalb nur eine Pflegezusatzversicherung ab, wenn Sie den Beitrag langfristig zahlen können. Wenn Sie den Vertrag vorzeitig kündigen müssen, weil der Beitrag zu hoch ist, verlieren Sie sämtliche eingezahlten Beiträge.
Gerade jüngere Menschen wissen häufig nicht, wie sich ihre finanzielle Situation entwickeln wird. Auch die allgemeine wirtschaftliche Situation und die Gesetzeslage in 30 bis 50 Jahren sind ungewiss. Wer unter 40 Jahre alt ist, sollte daher keine Pflegezusatzversicherung abschließen.
Achten Sie auf die Einzelheiten
Sie sollten vor Vertragsabschluss immer die Bedingungen im Detail prüfen.
Geförderte Verträge sind im Vergleich zu herkömmlichen Pflegezusatzversicherungen in einigen Punkten schlechter geregelt. Grundsätzlich können Sie Leistungen erst nach einer Wartezeit von 5 Jahren beanspruchen. Häufig entfällt diese Wartezeit zwar, wenn der Pflegefall aufgrund eines Unfalls eintritt. Ein Unfall ist jedoch in den seltensten Fällen Ursache für eine Pflegebedürftigkeit.
Besonders nachteilig ist, dass Sie den Beitrag auch im Pflegefall weiter zahlen müssen. Dadurch reduziert sich der Auszahlungsbetrag. Zahlreiche Angebote ohne Förderung sehen eine Beitragsbefreiung in Pflegegrad 5 oder 4 vor, andere bereits ab Pflegegrad 2 oder 3, einzelne sogar ab Grad 1.
Rechnen Sie mit steigenden Beiträgen
Die Versicherungsbeiträge werden nicht stabil bleiben. Zum einen können sie aufgrund einer vereinbarten Dynamik steigen. Zum anderen sehen die Verträge vor, dass die Beiträge steigen, wenn die Ausgaben hierfür über dem ursprünglich kalkulierten Niveau liegen. Dies wird künftig vermutlich der Fall sein, denn die Kosten in der Pflege werden steigen und auch die Zahl der Pflegefälle nimmt stetig zu. In welchem Umfang die Erhöhungen notwendig werden, ist nicht vorhersehbar. Bei den Verbraucherzentralen gehen immer wieder Beschwerden von Versicherten über jährliche Beitragssteigerungen ihrer geförderten Pflege-Zusatzversicherung ein.
Da jeder einen geförderten Vertrag erhält, werden im Verhältnis mehr Personen mit erheblichen Vorerkrankungen oder fortgeschrittenem Alter diese Policen abschließen. Daher ist die Prognose für die Beitragssteigerung dort schlechter als bei anderen Versicherungen ohne Förderung. Die monatliche Zulage von 5 Euro wird dies vermutlich nicht kompensieren können.
Zahlreiche Verträge beinhalten eine Dynamisierung der Leistungen bis zur Höhe der allgemeinen Inflationsrate. Das bedeutet, dass die vereinbarten Leistungen oder Tagegelder erhöht und an den Wertverlust angepasst werden. Dies ist ratsam, da andernfalls die häufig bereits geringen Beträge ihren Wert verlieren. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass bei einer Erhöhung des Leistungsumfangs der Beitrag entsprechend steigt. Je höher das erreichte Alter dann ist, desto höher fällt zudem der Preis dafür aus.
Zudem können die Verträge bei finanziellen Notlagen 3 Jahre ruhend gestellt oder gekündigt werden, wenn Sie sozialhilfebedürftig werden sollten. Bei einer Kündigung gehen jedoch sämtliche Einzahlungen verloren.
Das sagen die Verbraucherzentralen
Es ist zwar grundsätzlich von Vorteil, dass jeder einen geförderten Vertrag erhält, auch bei bestehenden Vorerkrankungen. Die Vertragsbedingungen sind jedoch vergleichsweise schlecht, so dass die Verbraucherzentralen in der Regel davon abraten.
Verträge zum monatlichen Mindestbetrag von 15 Euro decken meist nur die gesetzlichen Mindestleistungen ab oder wenig darüber. Leistungsstarke Tarife sind entsprechend teurer. Sie müssen dann mit Monatsbeträgen von 30 Euro und mehr rechnen, abhängig vom Alter und Leistungsumfang. Hier wird oft eine Kombination aus geförderten und nicht geförderten Tarifen angeboten. Dies ist eher nicht zu empfehlen.
Negativ ist außerdem, dass keine Beitragsbefreiung im Pflegefall vorgesehen ist, so dass die Leistungen tatsächlich noch geringer ausfallen.
Auch die Wartezeit von 5 Jahren ist im Vergleich zu gewöhnlichen Verträgen lang. Insbesondere die prognostizierte stärkere Beitragssteigerung der geförderten Tarife im Vergleich zu den ungeförderten Tarifen stellt ein großes Risiko und damit einen entscheidenden Nachteil für potentielle Versicherungsnehmer:innen dar.
Wenn Sie keine relevanten Vorerkrankungen haben, ist die geförderte Zusatzversicherung in der Regel nicht zu empfehlen. Für jüngere Menschen, die relevante Vorerkrankungen haben und gewöhnlichen Verträge nicht erhalten, könnten die Verträge unter Umständen interessant sein. Sie sollten aber ausreichende Leistungen wählen können. und der Vertrag sollte möglichst gute Konditionen enthalten. Zudem sollten Sie sich zunächst gegen grundlegende finanzielle Risiken absichern, wie eine Berufsunfähigkeit bei Berufstätigen und eine private Haftpflichtversicherung, abschließen
Ältere Menschen mit Vorerkrankungen erhalten meist lediglich die Mindestleistungen oder wenig darüber zu entsprechend hohen Beiträgen. Sie sollten den Vertragsabschluss angesichts der genannten Risiken und schlechteren Konditionen besonders kritisch prüfen.